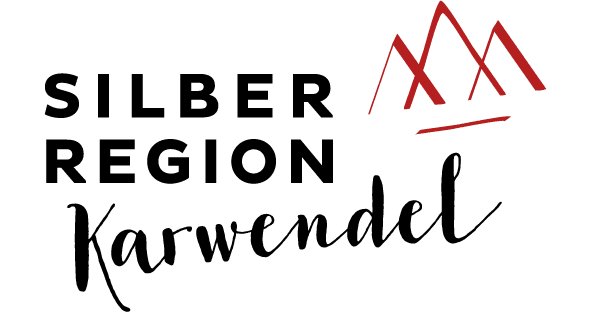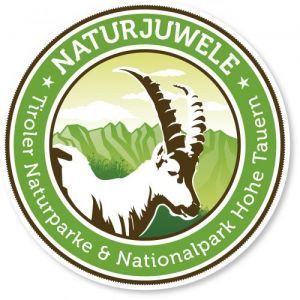Forschungsprojekte im Naturpark Karwendel

Das Karwendelgebirge ist in vielerlei Hinsicht für die Forschung interessant. Das zeigen aktuelle Forschungsprojekte aus so unterschiedlichen Disziplinen wie Vegetationsökologie, Geologie und Archäologie. Der Naturpark Karwendel ist hat es sich darum zur Aufgabe gemacht, diese vielfältigen Studien zusammenzutragen und für eine interessierte Öffentlichkeit zu bündeln. Hier finden Sie einen Überblick über diverse Forschungsprojekte im Karwendel!
Forschungsprojekte räumlich
Hier finden Sie eine Aufstellung unserer Forschungsprojekte, gegliedert nach räumlichen Schwerpunkten